Was wissen Studierte noch aus ihrem Studium? Studien jedenfalls zeigen, dass kaum jemand noch besonders viel davon weiß, was er oder sie sich jahrelang in Seminaren und Vorlesungen angehört hat. Akademiker zu sein, bedeutet eben nicht unbedingt, im Studium erworbene Kenntnisse im Beruf anwenden zu können. Akademiker zu sein, bedeutet Zugang. Zugang zu Berufen, Jobs und Milieus. Umgekehrt heißt das: Wer eine Lehre macht, hat diese Chancen nicht. Aber warum eigentlich? Und weshalb glaubt diese Gesellschaft so sehr, sie brauche möglichst viele Studierte? Wenn die Pandemie etwas gezeigt hat, dann doch, dass Schreibtischmenschen maßlos überschätzt sind. Menschen, auf die es wirklich ankommt, arbeiten als Pflegerinnen und Pfleger in Krankenhäusern, oder bei der Müllabfuhr und in Handwerksbetrieben.
Herz- und Hand-Berufe nennt der britische Autor und Journalist David Goodhart diese Arbeit in seinem Buch "Kopf, Hand, Herz - das neue Ringen um Status". Er ist überzeugt: Die Leistungsgesellschaften der Industrieländer haben den analytischen Kopf-Berufen in den vergangenen Jahrzehnten zu viel Gewicht gegeben. Wer nach Status und Anerkennung fragt, begibt sich direkt in die Selbstreflektion: Wem und was misst eine Gesellschaft Wert bei und warum? Und schon ist man tief in der Ungleichheitsdebatte. Die Folgen, glaubt Goodhart, ließen sich bis ins politische Machtgefüge ablesen: Wer an Status verliere, weil "fleißige Arbeit" nichts mehr zähle, verliere auch seine Identität und fühle sich politisch nicht vertreten. Es sei also nicht verwunderlich, dass populistische Politik in den USA und Europa deutlich mehr Anhänger finde.
Je mehr Menschen studieren, desto mehr von ihnen gehen einer Arbeit nach, für die kein Studium nötig wäre
Nun klingt das etwas verkürzt und ist keine neue These. Vom Statusverlust der eigenen Arbeiter-Eltern hat etwa bereits der französische Soziologe Didier Eribon in "Rückkehr nach Reims" erzählt. Goodhart schafft es aber, über das Populismus-Argument hinauszublicken: Er liefert kluge und detaillierte Einblicke, wann und warum die Gesellschaften der Industrienationen begonnen haben, Lehrberufe abzuwerten und das Studium als wichtigsten Zugang zu Aufstieg und Einfluss anzuerkennen.
Dafür nutzt er sowohl statistik-basierte und historische Argumente, als auch anekdotische Erzählungen von Experten und Betroffenen. So berichtet er von einem Büroangestellten, der seine Arbeit gerne und zuverlässig erledigte - bis er den Job verlor, weil für die Stelle ein akademischer Abschluss Voraussetzung wurde. Je mehr Menschen studieren, so Goodhart, desto mehr von ihnen arbeiten in Positionen, für die ein Studium nicht notwendig wäre - ja noch nicht mal nützlich. Auch der Zugang zu Führungspositionen wurde verbaut.
Heute, so zeigen es auch die Zahlen, sei ein Studium Kriterium, und nicht, ob sich der- oder diejenige im Betrieb auskenne und mit Menschen umgehen könne. Seinen Fokus richtet Goodhart auf Großbritannien und die USA, weitet den Blick aber auf andere Industrienationen wie Deutschland - und anerkennend auf die deutsche duale Ausbildung - zumal sich viele Entwicklungen vergleichen lassen.
Goodhart geht es nicht um Bildung als humanistisches Ideal, die kritischen Geist fördert - was er allerdings bezweifelt - und quasi Selbstzweck ist. Er betrachtet vor allem die Ausbildung, die sich anwenden lässt. Dabei erkennt er an, wie wichtig die Demokratisierung der akademischen Bildung im vergangenen Jahrhundert war: "Wirtschaft und öffentlicher Sektor benötigten mehr Köpfe und weniger Hände". Mehr Studierte seien heute aber "weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich vernünftig."
Ein höherer Akademikeranteil bedeute schließlich nicht mehr, dass auch die Produktivität steige. Zumal es auch nicht so sei, dass, wenn immer mehr Menschen studierten, diese anschließend zwangsläufig gebildeter seien. Die Universitäten würden zu Massen-Unis, die Qualität sinke, die Anforderungen ebenfalls, schreibt Goodhart. Viele Studiengänge "sind kein Nachweis einer wie auch immer gearteten kognitiven Befähigung". Es sei eine schlechte Investition, die die Gesellschaft da tätige, weil "wir zu viel für sinnlose Zertifizierungen ausgeben und nicht genug für berufliche, handwerkliche, technische und andere Ausbildung (...), wie sie unsere Gesellschaft dringender bräuchte".
Das Problem ist, dass wichtige Arbeit nicht unbedingt produktiv ist
Interessant wird das Buch vor allem, wenn Goodhart die Gründe aufschlüsselt, warum Gesellschaften bestimmte Wege einschlagen. So wertschätzen Industrienationen, was messbar ist, etwa in Kategorien wie Einkommen oder auch Dienstleistungs- und Warenwert. Das erklärt zum Teil, warum das Bruttoinlandsprodukt unbezahlte Arbeit wie Kindererziehung oder Hausarbeit nicht einbezieht. Auch professionelle Care-Arbeit ist nur bedingt produktiv: Man kann eben nicht immer mehr Menschen in kürzerer Zeit gesund pflegen. Ebenso lässt sich die Frage, wer eigentlich als intelligent gilt, mit der Messbarkeit analytischer Fähigkeiten erklären. Soziale und emotionale Intelligenz sind schwerer zu erfassen, ihr Stellenwert in Leistungsgesellschaften deutlich geringer.
Nun ist das Problem, das Goodhart schildert, ein bekanntes, die Rede vom "Fachkräftemangel" alltäglich, ohne dass Politik und Gesellschaft das Problem wirklich bekämpfen. Goodhart entmutigt das nicht. Er glaubt, dass schneller Wandel möglich ist, und verweist darauf, wie innerhalb kurzer Zeit Klimaschutz zur politischen Priorität wurde. Außerdem glaubt er an das Korrektiv des Marktes: Eine alternde Gesellschaft benötige schlicht mehr Pflegekräfte.
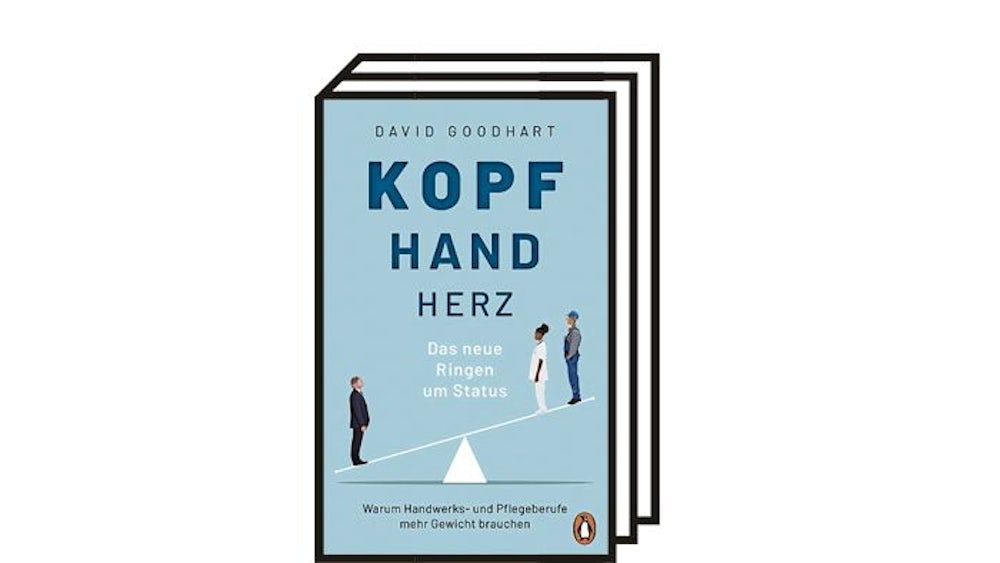
Woher er diesen Optimismus nimmt, wird nicht ganz klar, ist doch die Nachfrage nach Pflege bereits riesig - das Angebot allerdings bleibt aus. Schon überzeugender ist sein Argument, dass Automatisierung in den sozialen Berufen nur ergänzend einsetzbar ist, der Bedarf an menschennaher, emotional intelligenter Arbeit sogar steigt. Anspruchslos-analytische Arbeit hingegen, also die Jobs mittelmäßiger Akademiker, könne Software übernehmen. Auch da liegt Goodhart wohl richtig.
Szenarien für eine wünschenswerte Zukunft entwirft er selbstverständlich auch. Manche mögen sehr originelle Gedankenexperimente sein, inspirierend sind sie dennoch. Und anderes ist dann doch sehr konkret. So fordert er, häusliche Pflege ins Bruttoinlandsprodukt einzubeziehen, um die Arbeit in Familien anzuerkennen. Er glaubt an das identitätsstiftende Signal: "Wir haben Mobilität belohnt (...). Vielleicht sollten wir nun diejenigen belohnen, die zu Hause bleiben." Er fordert Gehältertransparenz und klügere Besteuerung und, ach ja, Liebe. Die Liebe zu den Kindern, die man Lesen lehrt, die Liebe zum Handwerk, das man ausführt.
Klingt nach romantischen Schwärmereien von Menschen, die hobbymäßig imkern? Ja, allerdings hat Goodhart einen wichtigen Punkt auf seiner Seite: Bullshit-Jobs, die niemanden glücklich machen, gibt es schon genug. Und wenn Pflegekräfte wirklich pflegen könnten, statt Alte und Kranke im Minutentakt unter die Dusche wuchten zu müssen, dann hätten sie vielleicht sogar Zeit für ein bisschen Liebe.
